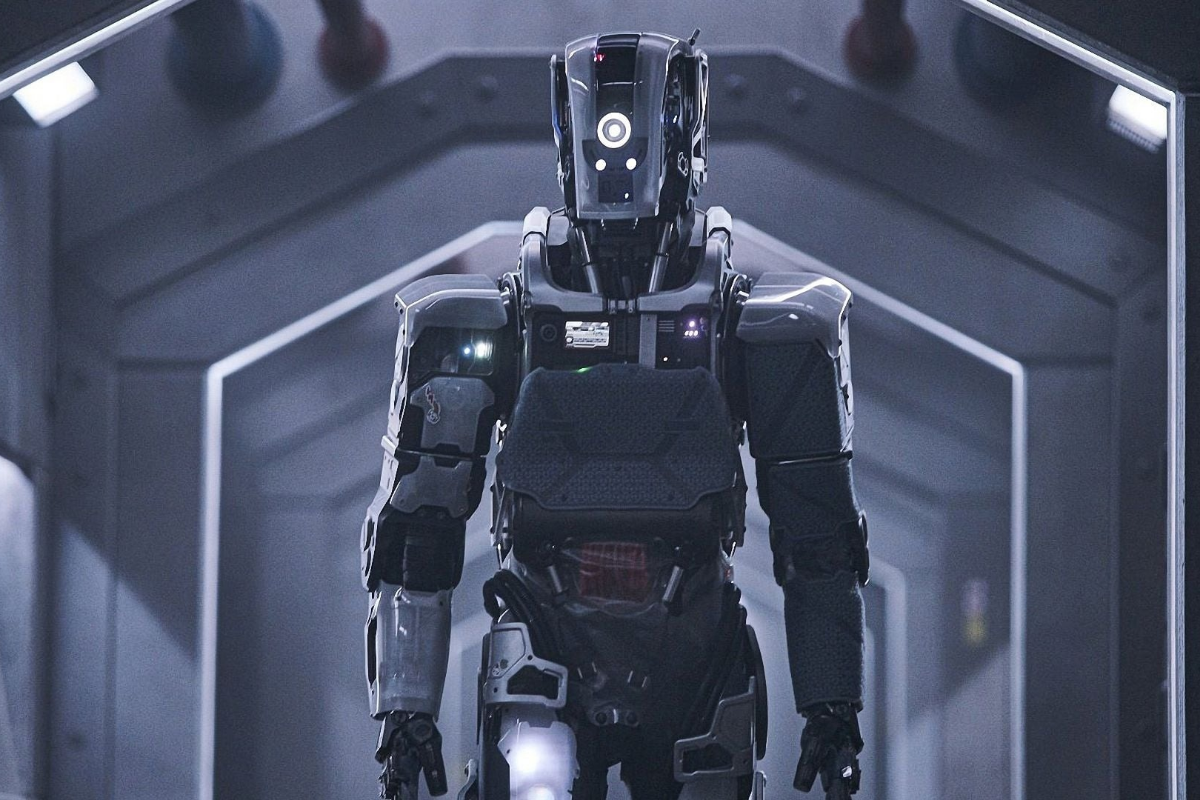Das Grauen der Sklaverei in den Vereinigten Staaten
Die auch heute noch nicht vollends überwundene Ungleichheit zwischen weissen und schwarzen US-Amerikanern hat ihren traurigen Ursprung im transatlantischen Sklavenhandel. Millionenfach wurden seit Anfang des 17. Jahrhunderts Afrikaner eingefangen, unter denkbar unmenschlichen Bedingungen über den Ozean verfrachtet und fristeten anschliessend ständigen Demütigungen und Gewaltausbrüchen ausgesetzt, ein tristes Dasein auf den Plantagen im Süden der Vereinigten Staaten. Ihren Geschichten widmeten sich Film und Fernsehen nur zögerlich. Lange Zeit waren Afroamerikaner Randfiguren. Klischeehaft gezeichnet, traten sie entweder als treu ergebene Diener auf oder aber als wilde Tiere. Erst nach und nach, besonders im Zuge der Dekolonisation, warfen Drehbuchautoren und Regisseure einen kritischeren Blick auf eines der düstersten Kapitel der US-Geschichte. Anlässlich der Ausstrahlung von Quentin Tarantinos Italowestern-Hommage „Django Unchained“ möchten wir einige wichtige Filme und Serien zum Thema vorstellen.
„Roots“ (1977)
Darum geht’s: Mitte des 18. Jahrhunderts wird der zur Volksgruppe der Mandinka gehörende Jugendliche Kunta Kinte (LeVar Burton) aus seinem Dorf im westafrikanischen Gambia entführt und auf ein Schiff gebracht, das einen Hafen in Maryland ansteuert. Dort erwirbt ihn der Plantagenbesitzer John Reynolds (Lorne Greene) und benennt ihn in Toby um. Fiddler (Louis Gossett Jr.), ein älterer Sklave, soll den jungen Mann in seinen neuen Alltag einführen. Kunta weigert sich jedoch standhaft, seine Identität komplett aufzugeben. Der Wunsch nach Freiheit realisiert sich allerdings erst für seine Nachfahren.
Sehenswert, weil… die ursprünglich achtteilige Miniserie eine sieben Generationen umspannende Chronik an die Wand wirft, in der die persönlichen Erfahrungen einer afroamerikanischen Familie mit politischen Ereignissen und den Wirren des Bürgerkriegs verbunden werden. Als Grundlage diente der gleichnamige Roman aus der Feder von Alex Haley, der darin die zuvor nur mündlich tradierte Geschichte seiner Ahnen zu Papier gebracht hatte. Die mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete ABC-Produktion entstand unter Mitwirkung des Schriftstellers und zeichnet ein detailreiches Bild der Sklavereigesellschaft. Der Einfluss der Miniserie zeigt sich auch daran, dass 2016 ein Remake für den History Channel produziert wurde, das bei den Kritikern viel Lob und Anerkennung fand.

„Sankofa“ (1993)
Darum geht’s: Die als Model arbeitende Afroamerikanerin Mona (Oyafunmike Ogunlano) reist für ein Fotoshooting zum Cape Coast Castle nach Ghana und ahnt nicht, dass der Ort ihres Drehs früher als Sammelpunkt für Sklaven diente, denen die Fahrt über den Atlantik bevorstand. Als die junge Frau dem rätselhaften Trommler Sankofa (Kofi Ghanaba) begegnet, ermahnt dieser sie, sich ihrer Wurzeln zu erinnern. Nach dem Betreten der Kerkeranlage taucht Mona nur wenig später auf wundersame Weise in das Leben einer Haussklavin namens Shola auf einer Zuckerrohrplantage ein.
Sehenswert, weil… hier einmal nicht aus einer weißen Perspektive auf den Sklavenalltag geblickt wird. Vielmehr rückt der in Äthiopien geborene Regisseur Haile Gerima die afrikanische Sicht in den Mittelpunkt und beschränkt sich nicht nur darauf, die Brutalität des Plantagendaseins zu schildern. „Sankofa“ handelt auch davon, wie die eigene Identität verloren geht, wie wichtig es ist, sich seiner Ursprünge zu versichern, und zeigt die Sklaven trotz aller Qualen nicht nur als Opfer, sondern als Menschen, die ihre Geschichte, ihr Schicksal aktiv gestalten. Gerade dieser Punkt geht in vielen, von nichtafrikanischen oder nichtafroamerikanischen Regisseuren gedrehten Filmen unter. Das Leid der Schwarzen wird beschrieben. Im Zentrum steht allerdings oft eine weiße Figur, die sich zum großen Helfer aufschwingt.

„Amistad“ (1997)
Darum geht’s: Während einer Reise kommt es im Jahr 1839 an Bord eines Sklavenschiffes unter der Führung des Afrikaners Sengbe Pieh alias Cinque (Djimon Hounsou) zu einem Aufstand, der mit dem Sieg der Gefangenen und der Ermordung fast der gesamten Crew endet. Einige Monate später wird der Frachter vor der Küste Connecticuts aufgebracht, und die Meuterer finden sich plötzlich vor einem Gericht wieder, da verschiedene Parteien Besitzansprüche geltend machen. Die Verteidigung der Sklaven übernimmt der Anwalt Roger Baldwin (Matthew McConaughey), der durch die Gespräche mit Cinque mehr über die Hintergründe erfährt.
Sehenswert, weil… Steven Spielberg den wahren Fall mit großem Aufwand, dramatischer Kraft und so authentisch wie möglich rekonstruiert. Die afrikanischen Figuren dürfen ihre Sprache behalten. Am Beispiel des Prozesses wird die erbitterte Auseinandersetzung zwischen Befürwortern und Gegnern der Sklaverei illustriert. Und zudem zeigt das Historiendrama eine Wahrheit, die ähnliche Werke häufig ausblenden: Cinque wird von den Mitgliedern eines anderen afrikanischen Stammes gefangen genommen und danach an weiße Sklavenhändler verkauft. Eine damals weitverbreitete Praxis. Problematisch ist zweifelsohne, dass „Amistad“ den schwarzen Figuren unter dem Strich zu wenig Entfaltungsraum gewährt. Vor allem gegen Ende scheint es Spielberg wichtiger zu sein, ein Loblied auf die US-amerikanische Demokratie zu singen.

„Lincoln“ (2012)
Darum geht’s: Kurz vor dem Ende des Bürgerkriegs zwischen den amerikanischen Nord- und Südstaaten will der republikanische Präsident Abraham Lincoln (Daniel Day-Lewis) die Sklaverei per Verfassungszusatz abschaffen. Für die im Senat bereits beschlossene Verabschiedung benötigt er allerdings noch eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Repräsentantenhaus. Der Beginn eines zähen politischen Ringens, bei dem nicht nur die Demokraten Lincoln Steine in den Weg zu legen versuchen, sondern auch Vorbehalte in den eigenen Reihen für Komplikationen sorgen.
Sehenswert, weil… sich der von Steven Spielberg (schon wieder!) inszenierte und in vielen Rollen prominent besetzte Film über einen wegweisenden Beschluss die Zeit nimmt, die Streit- und Redekultur genauestens zu beschreiben. Mit seiner zweieinhalbstündigen Laufzeit und seiner Wortlastigkeit verlangt „Lincoln“ dem Zuschauer zwar einiges an Geduld ab, liefert aber einen aufschlussreichen Einblick in das Taktieren auf dem politischen Parkett. Hauptdarsteller Daniel Day-Lewis erhielt für seine Performance als früherer US-Präsident nicht unverdient seinen dritten Oscar.

„Django Unchained“ (2012)
Darum geht’s: Als der deutsche Zahnarzt Dr. King Schultz (Christoph Waltz), der in Amerika sein Geld als Kopfgeldjäger verdient, auf eine Gruppe von Sklaven trifft, befreit er Django (Jamie Foxx) aus seiner Gefangenschaft und will ihn endgültig ziehen lassen, sobald dieser ihm bei einer beruflichen Angelegenheit geholfen hat. Im Laufe ihrer Zusammenarbeit entsteht jedoch eine freundschaftliche Beziehung. Und so beschließen sie, gemeinsam nach Djangos Frau Broomhilda (Kerry Washington) zu suchen.
Sehenswert, weil… Quentin Tarantino in seiner anspielungsreichen Hommage an den Italowestern, speziell an Sergio Corbuccis Kultstreifen „Django“, eine Geschichte mit lässigen Dialogen und blutigen Eskalationen erzählt, die stets unterhaltsam ist, in manchen Momenten handfesten Nervenkitzel produziert, zugleich aber – auf verquere Weise, versteht sich – etwas über die grausamen Auswüchse der Sklaverei zu sagen hat. Ins Bild passt auch, dass eine der schillerndsten Figuren der von Samuel L. Jackson gespielte, seinem Besitzer treu ergebene Vorsteher Stephen ist. Dass Rache hier, wie so oft bei Tarantino, ausgiebig zelebriert wird, darf man kritisch hinterfragen. Andererseits lässt sich eine gewisse Genugtuung nicht verleugnen, wenn Django den weißen Sklavenhaltern und ihren Helfern ordentlich einheizt.

„12 Years a Slave“ (2013)
Darum geht’s: Im Jahr 1841 führt der freie Afroamerikaner Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor) mit seiner Familie ein ruhiges Leben im Bundesstaat New York. Als der Geiger einen vermeintlich lukrativen Auftrag annimmt, findet er sich allerdings schon bald in einem Albtraum wieder. Sklavenjäger haben ihn betäubt und in die Südstaaten verkauft, wo er auf die Plantage des gemässigten William Ford (Benedict Cumberbatch) gelangt. Obwohl er dort schnell einen guten Eindruck hinterlässt, wird er einige Zeit später an den brutalen Edwin Epps (Michael Fassbender) weitergereicht, auf dessen Anwesen Solomon die Hölle auf Erden erwartet.
Sehenswert, weil… Regisseur Steve McQueen uns mit unverstellter Schonungslosigkeit eine eher unbekannte Facette der Sklaverei näher bringt: Auch freie, in der Gesellschaft angesehen Afroamerikaner waren vor den Fängen der Sklavenhändler nicht sicher. Dass der Film eine wahre Geschichte erzählt, macht das Ganze nur noch beklemmender. Manche Szenen, etwa der Moment, in dem der Protagonist minutenlang an einem Strick baumelt und ums Überleben kämpft, sind fast unerträglich, fallen aber keineswegs in die Kategorie „Billiger Voyeurismus“. McQueen und Drehbuchautor John Ridley begehen zum Glück nicht den Fehler, den Verschleppten auf plumpe Weise zu einem Helden zu stilisieren, sondern zeigen ihn als einen Mann, der sich im Angesicht der schlimmsten psychischen und physischen Angriffe seine Menschlichkeit bewahrt. Zu den Stärken des mit drei Oscar-Statuen prämierten Historiendramas gehört auch die zum Teil erfreulich differenzierte Figurenzeichnung. Nicht alle Schwarzen sind unschuldig. Und nicht alle Weißen sind erbarmungslose Teufel. Eben diese Schattierungen lassen das auf Solomon Northups Memoiren beruhende Geschehen noch lebendiger erscheinen.

„The Underground Railroad“ (2021)
Darum geht’s: Als ihr Leidensgenosse Caesar (Aaron Pierre) sie bittet, mit ihm von der Baumwollplantage in Georgia zu fliehen, winkt die Sklavin Cora (Thuso Mbedu) zunächst ab. Die Grausamkeiten, die sie kurz darauf mitansehen muss, bringen die junge Frau jedoch zum Umdenken. Gemeinsam wollen sie über ein unterirdisches Eisenbahnnetz flüchten, das Sklavereigegner errichtet haben, um Schwarze aus ihrer Notlage zu befreien. Cora und Caesar schaffen es an Bord des Zuges und landen schließlich in einer Stadt in South Carolina, in der sich Afroamerikaner frei bewegen dürfen. Während ihnen der Sklavenjäger Ridgeway (Joel Edgerton) auf den Fersen ist, begreifen die beiden, die sich inzwischen zueinander hingezogen fühlen, dass der schöne Schein ihrer neuen Existenz trügt.
Sehenswert, weil… Barry Jenkins in der zehnteiligen Miniserie, die auf dem gleichnamigen Roman von Colson Whitehead basiert, viele unterschiedliche Ausprägungen der Repression und des Rassismus erforscht. Magischer Realismus trifft hier auf die Stilmittel des Horrorkinos, die immer wieder dazu dienen, den Schrecken der Sklaverei und der Verfolgung erfahrbar zu machen. Jedes Mal, wenn man denkt, schlimmer könnte es für die Hauptfigur nicht mehr kommen, wird man eines Besseren belehrt. In Thuso Mbedus mitreissendem Spiel scheinen sowohl Verletzlichkeit und Angst als auch Entschlossenheit und Wut auf. Spannend ist überdies, dass manche Nebenfiguren klassische Muster unterlaufen und ungeahnte Brüche aufweisen. Besonders ins Auge sticht in diesem Zusammenhang Ridgeways kleiner Assistent Homer (Chase Dillon), der selbst ein Afroamerikaner ist und die Jagd seines Chefs mit beunruhigender Präzision unterstützt. Das titelgebende Fluchthelfernetzwerk existierte übrigens tatsächlich – allerdings nicht als geheime, weitverzweigte Eisenbahnstrecke. Dabei handelt es sich um eine kreative Ausschmückung des Romanautors.

 Beitrag von
Beitrag von